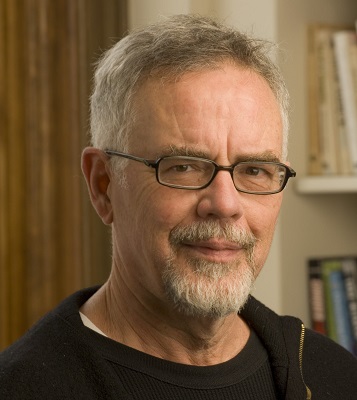Der Eltern-Kind-Konflikt – evolutionäre Psychologie
Trivers Theorie des Eltern-Kind-Konfliktes
Wie kleine Geschosse prasseln die Tropfen des Gewitterregens ins Grün der Urwaldriesen. Auf Gombe, dem großen Naturschutz- reservat östlich des Tanganjikasees, geht ein rauschender Wol- kenbruch nieder.
Die drei Schimpansinnen im Dickicht fühlen sich langsam wieder besser – obwohl jeder Donnerschlag sie noch zusammenzucken lässt. Sie horchen und lauschen, aber das Getöns um sie herum verschluckt alles.
Gewitterguss und Dämmerung haben ihre Feinde hoffentlich verscheucht. Fremde Männchen hatten die drei überfallen – einfach so –, und es befanden sich Kinder und Halbwüchsige in ihrer Obhut; und männliche Schimpansen können grausam sein.
Der plötzliche Wolkenbruch hat die Weibchen vor dem Schlimmsten bewahrt. Aber der Schreck steckt den Äffinnen immer noch in den Knochen; ihren Kindern jedoch wird es langsam langweilig und ungemütlich.
Entwöhnung ist schwer
Ein Halbstarker hat Schutz und Zuflucht bei seiner Mutter gesucht. Noch immer hängt er an ihr und möchte die Gunst der Stunde nutzen und etwas Milch abbekommen – obwohl er eigentlich schon längst entwöhnt sein sollte. Die Schimpansin verweigert sich seinem Ansinnen; es gibt Gezeter, Geschrei und Drama. Schließlich umarmt sie ihn und drückt ihn fest an sich; der Bassige aber schlägt und beißt – wie ein menschliches Kind, das sich in einen Tobsuchtsanfall hineinsteigert. Die Anderen werden unruhig: Wie leicht kann das Getue des Verrückten die Feinde wieder herbeibringen. Mit Engelsgeduld bringt die Schimpansin die Situation unter Kontrolle; ihre zärtliche Zuwendung zeigt Wirkung – der Außer–sich–Geratene wird langsam wieder friedlich und ruhig.
Schimpansenmütter säugen ihre Kinder für lange Zeit – oft fünf Jahre lang. Natürlich fangen die Jungen an, in dieser Zeit Grünzeug und Früchte zu futtern, aber die warme Mutterbrust ist immer noch ihr liebster Ort.
Irgendwann kommt dann aber der Zeitpunkt, wo das Schimpansenjunge es akzeptieren muss, wie ein menschliches Kind auch, dass die bequeme Versor- gung ein Ende hat. Schimpansinnen haben ja immer nur ein Junges, aber ab einem gewissen Alter des Nachwuchses werden sie wieder brünstig und paaren sich mit den Männchen der Gruppe.
Skurrile Szenen können sich abspielen wenn ein Sprössling bemerkt, dass er nicht mehr der Lebensmittelpunkt seiner Mutter ist. So kann es passieren – in einem Anfall von Eifersucht –, dass ein Halbstarker probiert die angetretenen Freier von seiner Mama weg zuhalten; von der tiefen Erkenntnis geführt, dass in Bälde ein anderes Kind seinen Platz einnehmen wird.
Anzahl der Jungen genetisch festgelegt
Diese Mutter–Kind–Konflikte sind in der Natur universell. Der amerikanische Evolutionsbiologe und Soziologe Robert Trivers hat sich in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt und Fachwelt und breite Öffentlichkeit auf den Interessenskonflikt zwischen Mutter und Kind hingewiesen (Das Foto ist hier erschienen).
Über viele Jahrmillionen hat die Evolution darauf „abgezielt” die Weibchen bei allen Tierarten so zu konstruieren, dass sie im Laufe ihres Lebens eine maximale Anzahl von Jungen in die Welt setzen können. Dieses Maximum ist genetisch vorgegeben; aber es ist zugleich auch das Optimum – das nicht überschritten werden kann.
Stellen Sie sich vor, die normale Gelegegröße einer Amsel sind fünf oder sechs Eier. Nehmen wir an durch eine Mutation entsteht eine Amsel, die in der Lage ist, acht oder neun Eier zu legen. Lassen wir die Probleme weg, die sich ergeben, wenn ein Amselpaar acht oder neun Eier ausbrüten müsste. Nehmen wir weiter an, es sitzen nach 17 Tagen Brutdauer – statt fünf junger Amseln – derer acht im Nest. Das Elternpaar hätte nun eklatante Schwierigkeiten die Schreihälse zu stopfen; nicht gleich zu aller Anfang, aber später, wenn sie größer geworden sind und mehr an Würmer, Schnecken und Käfer verlangen, als die fleißigen Eltern heranschaffen können.
Da die Eltern das Futter in etwa gleich verteilen, leiden irgendwann alle acht Jungen mehr oder weniger stark an Abmagerung. Irgendwann sind vielleicht auf einem Schlag fünf tot. Die verbleibenden drei fangen sich und werden groß. Ausbeute der Eltern: Aus acht gelegten Eiern sind drei Junge groß geworden. Aus der Sicht der Eltern ist das ein sehr schlechtes Ergebnis; aus der Sicht der gestorbenen Jungen sowieso.
Da Amselweibchen mit normalen Gelegegrößen mehr Junge groß bringen als die Viel–Eier–Legerin, wird das Gen, das für acht Eier verantwortlich ist, in der Amselpopulation wieder verschwinden, weil es nur Nachteile mit sich bringt. Aus der Sicht eines Amselweibchens sind fünf Eier und fünf ausgeflogene Jungen das optimal mögliche Ergebnis.
Jungtiere sind egoistisch
Aber, wie schaut das Ganze aus dem Blickwinkel eines frisch geschlüpften Amselkükens aus? Ist das für ein Amselkind okay noch vier Geschwister im Nest zu haben? Ja und nein könnte man sagen!
Jedes Lebewesen auf Erden hat die eine Hälfte seiner Gene vom Vater und die andere Hälfte von seiner Mutter. Der Verwandtschaftsgrad mit seinen Eltern und seinen Geschwistern ist demnach ½. Aber mit der anderen Hälfte seiner Gene hat ein Lebewesen keine Übereinstimmung mit seiner Verwandtschaft. Biologen erklären aus diesen Tatsachen die Existenz der Geschwister–Rivalität und die Konflikte zwischen Eltern und Jungen.
Deshalb wäre es aus der Sicht eines Amselkükens auch idealer, wenn es nur alleine im Nest wäre und die Investitionen die ein Amselpaar für seine Jungen aufbringt alleine ihm zugute kommen würden. Diese paradiesische Situation würde einem Amselküken maximale Überlebenschancen einräumen: Würde der Vogelpapa z. B. von der Hauskatze gefressen werden, hätte die Amselmama noch genügend Investitions- reserven das Einzelkind zu versorgen. Schlechtwetterperioden mit eingeschränkter Futtersuche wären auch kein Thema – für ein Junges würde es allemal reichen.
Aber aus der Sicht des Amselweibchens ist ein einziges Junges viel zu wenig. Wird das Junge von der Hauskatze gefressen – viele junge Amseln verlieren ihr Leben durch Katzen – hätte das Amselpaar in der Brutperiode überhaupt keinen Nachwuchs auf die Füße gebracht. Gene, die in diese Richtung tendieren, haben deshalb keine Chance sich im Genpool der Amseln auszubreiten. Also bleibt es bei mehreren Jungen, auch wenn das für das einzelne Amselküken ein Nachteil ist.
Unser rabiater, halbstarker Schimpansenjüngling im obigen Beispiel hat zwar keine gleichaltrigen Ge- schwister als Rivalen, gleichwohl rivalisiert er mit fiktiven Geschwistern in der Zukunft, weil er die Labsal der warmen Muttermilch über die notwendige Zeit hinaus für sich beanspruchen will. Die Schimpansen- mütter sehen das natürlich anders und möchten ihre Investitionen ab einem gewissen Zeitpunkt abziehen und sie für die Aufzucht weiterer Kinder verwenden; das ist ihr biologisches Programm, dem sie Rechnung tragen wollen.
Die kanadischen Evolutionspsychologen Margo Wilson und Martin Daly formulierten die Theorie des Eltern–Kind–Konfliktes an einem schönen Beispiel, das mit Investitionseinheiten arbeitet, für die sie Zahlen angegeben haben:
Mütter müssen gerecht sein
Eine Mutter hat zwei Kinder, die sie versorgen muss. Sie kommt von der Futtersuche und bringt zwei Nahrungsrationen mit nach hause. Man muss wissen, dass zwei identische Nahrungsrationen, die ein Kind nacheinander isst, einen etwas unterschiedlichen Nutzen für den Körper haben. Nehmen wir einen Organismus – der energetisch gesehen am tiefst möglichen Punkt steht – nahe am Verhungern:
Für ihn wird die erste Futterration von überragender Wichtigkeit sein, denn sie entscheidet über Leben und Tod. Die zweite ist zwar auch wichtig, aber nicht ganz so wie die erste, die den Organismus vom Hungertod bewahrt.
Wenn man den Wert der Futterrationen in Zahlen angeben wollte, könnte man sagen, dass die Futterration eins den Wert vier für den Körper hat und die Futterration zwei (dieselben Kalorien wie eins) den Wert drei.
Für die Mutter ist es am Idealsten jedem der Kinder eine Futterration zu geben, denn dann hat jeder der Körper vier Nutzeinheiten erhalten. Die acht Nutzeinheiten, die die Mutter zu vergeben hat, hätte sie gerechterweise auf zwei mal vier aufgeteilt. Würde einer beide Rationen bekommen, hätte er einen Nutzen von sieben; der andere hätte natürlich einen von null. Für die Mutter wäre das schlecht, weil eines ihrer Kinder dabei hungern müsste und das andere nur einen Nutzen von sieben aus ihrer Futterbeschafferei gezogen hätte; während sie grundsätzlich acht Einheiten zu vergeben hätte.
Aus der Perspektive der Geschwister bzw. ihrer Gene sieht das Ganze aber anders aus: Sie haben jeweils fünfzig Prozent ihrer Gene gemeinsam, aber ein Kind ist jeweils zu einhundert Prozent mit sich selbst verwandt. Das bedeutet, dass ein Geschwister an seinem eigenen Wohl doppelt so stark interessiert ist wie an dem seines Bruders.
Geschwister rivalisieren
Wenn Hans seine Ration verzehrt haben er bzw. seine Gene daraus den Nutzen vier. Wenn Fritz seine Ration verzehrt haben seine Gene und er daraus ebenso den Nutzen vier. Hans bzw. seine Gene profitieren aber auch dann, wenn sein Bruder Fritz isst, denn Fritz trägt immerhin fünfzig Prozent der Gene von Hans. Da Fritz ebenso vier Einheiten verzehrt, profitieren die Gene von Hans, die auch in Fritz stecken, davon nochmals um zwei Einheiten.
Das heißt, die gemeinsamen Gene in Hans und Fritz profitieren bei gleicher Nahrungsverteilung jeweils von sechs Einheiten. Bekäme Hans aber beide Portionen, hätte er daraus den Nutzen sieben – also eine Einheit mehr. Es ist klar, dass Hans Versuche anstellen wird, seine Mutter dahingehend zu beeinflussen, dass er mehr bekommt als ihm zusteht.
Diese Bestrebungen interferieren mit der Motivation der Mutter, die ihre Investitionen gerecht verteilen möchte. Diese biologischen Begeben- heiten führen zu Spannungen und Rivalitäten zwischen den Geschwistern und zu Krisen und Konflikten zwischen Eltern und Kindern.
Eingeborene in archaischen Kulturen stillen gewöhnlich ihre Kinder drei bis vier Jahre lang. Danach erfolgt die Entwöhnung, die oft mit einem regelrechten Abstillschock einhergeht. Kinder in solchen Kulturen laufen aber noch in einem Alter von fünf bis sechs Jahren zu ihren Müttern, wenn sie sich vor etwas fürchten oder wenn ihnen etwas weh tut, um an der Mutterbrust saugend sich zu beruhigen (Eibl–Eibesfeld, 1984).
Eine harmlose Variante des Abstillschocks zeigt z. B. das kleine deutsche Mädchen, das noch im Vorschulalter mit ihrem Schnuller im Mund durch die Gegend rennt. Nach Daly und Wilson sind Konflikte zwischen Eltern und Sprösslingen nicht auf die Kindheit beschränkt, sondern beständig zwischen den Generationen wirksam, oftmals natürlich ganz versteckt und unbewusst.
Es ist klar, dass die Evolution bei solch einer „Gegnerschaft” begonnen hat, in den Kindern manipulative Elemente zu entwickeln, die Eltern dazu bringen sollen, mehr als den gerechten Anteil an Investitionen auszuspucken. Die Eltern wiederum haben genetische Anpassungen entwickelt, die sie die „Falschheiten” ihrer Sprösslinge erkennen lassen – um ihrer Ausbeutung und Ausnutzung einen Riegel vorzuschieben.
Die Konflikte zwischen den Generationen setzen aber schon viel, viel früher ein, wie der Biologe David Haig eindrucksvoll zeigen konnte.
| Vorhergehender Text | Fortsetzung: |