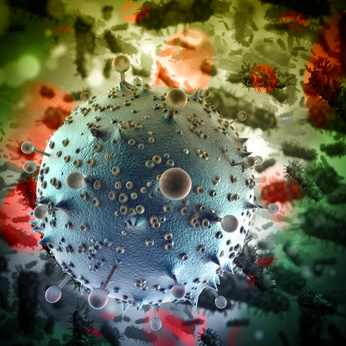Der Mensch und die Natur – evolutionäre Psychologie
Der Mensch im Kampf gegen die Kräfte der Natur
Jedes neugeborene Lebewesen auf Erden ist von allem Anfang an großen Gefahren ausgesetzt, die von der unbelebten Natur genauso ausgehen wie von der belebten. Tiere benötigen z. B. eine ausreichende Menge an Atemluft, d.h. der Sauerstoffgehalt der Luft darf einen bestimmten kritischen Wert nicht unterschreiten, sonst ersticken sie. Die Umgebungstemperatur, abhängig von klimatischen Bedingungen, ist der nächste wichtige Parameter, der weder zu hoch noch zu niedrig sein darf.
Über viele, viele Jahrmillionen haben alle Lebewesen auf Erden körperliche Anpassungen entwickelt, um mit diesen Bedingungen fertig zu werden. Natürlich darf ein Tier sich nur in denjenigen Lebensräumen aufhalten, für die es solche evolutionären Anpassungen entwickelt hat – d.h. es muss sich auf Erden am richtigen Fleck befinden. Ein Drückerfisch zum Beispiel, normalerweise beheimatet im Flachwasser eines Korallenriffes, wird den physikalischen Gegebenheiten nicht standhalten können, wie sie in der Tiefsee herrschen.
Das Leben ist hart und beschwerlich
Parasiten, Bakterien, Pilze, Viren – all diese Lebensformen haben ihr Refugium im Inneren oder auf der Oberfläche von größeren Lebewesen und können sie, unter gewissen Bedingungen, schwer schädigen oder gar töten. Wirte und Parasiten liefern sich seit unvorstellbar langen Zeiten ein evolutionäres Wettrennen, in dessen Zentrum ein spezielles körperliches Abwehrsystem steht, das die schwierige Aufgabe hat, einen Sieg der Winzlinge zu vereiteln.
Aber auch der Makrokosmos enthält genügend Gefahren, die aller Orten auf ein Lebewesen lauern: Viele müssen mit der Bedrohung durch natürliche Feinde leben, die sie zum Fressen gerne haben. Und last not least sind da die Angehö- rigen der eigenen Art, die einem Tier das Leben schwer machen, denn alle Arten produzieren stets mehr Nachkommen, als in der Natur ein Auskommen haben.
So ist es zwangsläufig, dass um limitierte Ressourcen wie Nahrung, Reviere, Geschlechtspartner usw. ein Konkurrenzkampf entbrennt, den nur die Tüchtigsten und am besten Angepasstesten erfolgreich meistern können. Die weniger Erfolgreichen können sich nicht behaupten und gehen unter oder sind zu einem elenden Schattendasein verdammt.
Der Mensch hat es als einzige „Tierart” geschafft, sich durch seine kulturellen Errungenschaften teilweise von diesen Widrigkeiten zu befreien. Aber er hat noch in einem hohen Ausmaß – in den Genen gespei- chert – Verhaltensweisen, die Anpassungen an seine archaische, vorkulturelle Lebensweise sind.
Nahrung ist das Allerwichtigste
Für alle Lebewesen ist es fundamental, Zugang zu Nahrungsquellen zu haben, denn ein Tod durch Verhungern ist im Tierreich gar nicht so selten. Es kann ungeschickte und unerfahrene Raubtiere genauso treffen, wie gemächliche Pflanzenfresser, die in Notzeiten, z.B. im Winter, keine ausreichenden Möglichkei- ten haben, an ihre Futterpflanzen zu gelangen.
Tiere verbringen unterschiedlich viel Zeit damit Nahrung zu suchen und aufzunehmen. Das hat mit den Kalorien zu tun, die in ihren Hauptnahrungsquellen enthalten sind. Fleischfresser wie Leopar- den z. B. haben es gut: Waren sie erfolgreich, schlagen sie sich den Bauch mit einer Antilope voll und brauchen dann tagelang nicht mehr zu jagen – weil Fleisch eben sehr nahrhaft ist. Die armen Antilopen dagegen rupfen und grasen den ganzen Tag, um sich ihre Kalorien mühsam zusammen zusammeln.
Der Mensch als Allesfresser hatte es da ein klein wenig besser, obwohl, in seiner evolutionären Vergangenheit, ganz zu Anfang, das energiearme Grünzeug auch sein Hauptfutter bildete – das umständlich zusammengeklaubt werden musste. Fleisch war mit Sicherheit eine eher seltene Kost auf dem Speiseplan, und die Supermärkte waren noch nicht erfunden, in denen der moderne Mensch sich heutzutage mit allerhand Köstlichkeiten eindecken kann.
So galt für unsere Vorfahren die Devise: Laufen, Sammeln und Jagen – von früh bis spät und aufpassen dabei, dass man selber nicht gefressen wurde. Ein widriges, hartes und beschwerliches Leben, das zudem über Jahrmillionen unserer Entwicklungsgeschichte in der Gluthitze der afrikanischen Savanne stattfand.
Der heutige Mensch kann sich – wenn er in Friedenszeiten sicher im Schutze seiner Zivilisation lebt – keine Vorstellung davon machen, was es heißt, am Morgen noch nicht zu wissen, ob man am Abend einigermaßen satt geworden ist. Diese Alltagsnöte peinigten unsere Vorfahren in archaischer Ver- gangenheit aber tagtäglich und man kann sich denken, dass ein Großteil ihres Lebens – auch in ihren Gedanken –, sich mit Nahrung und Essen beschäftigt hat. Nahrung im Überfluss zu haben und essen zu können, bis einem der Bauch platzt, war für Urmenschen etwas Unglaubliches – das selten genug vor- kam.
Große Aufregung und überschwängliche Freude befällt Ureinwohner überall auf der Welt, wenn von den Männern des Dorfes eine besonders große und fette Jagdbeute antransportiert wird. Das anschließende Festessen ist jedes Mal mit einem ausgelassen Treiben verbunden, das einem an modernen Volks- festtrubel erinnert oder an die Geselligkeit unserer Straßenfeste. In unserer Vergangenheit vor Hunderdtausenden von Jahren, dürfte es nicht anders gewesen sein.
Teilen erhält die Freundschaft
So ein Festessen hat eine viel tiefere Bedeutung und geht weit über das bloße Abfüllen hungriger Mägen hinaus. Ein Festessen – an dem alle teilnehmen – ist ein Großereignis, das eine wichtige soziale Funktion erfüllt und das Wir–Gefühl der Gruppe stärkt. Gemeinsame Festivitäten – mit speziellen Fressorgien –, können aber noch weiter gehendere Funktionen erfüllen: Gastgeber können damit Macht und Reichtum demonstrieren. Solche speziellen Festlichkeiten werden unter anderem in der Absicht organisiert, die geladenen Gäste zu beschämen – um die Größe des Gastgebers herauszustreichen. Prestigeveranstal- tungen dieser Couleur werden z. B. von bestimmten Indianerstämmen Kanadas zelebriert.
Das Potlatsch ist ein Fest der Verschwendungssucht: Häuptlinge der Kwa- kiutl–Indianer in Vancouver laden zum großen Fressen und Brassen. Am Höhepunkt dieser Großmannsucht werden wertvolle Gegenstände vom gast- gebenden Häuptling zerstört oder unbrauchbar gemacht: Kostbare Öle z. B. – aufwendig in ihrer Herstellung – werden ins Feuer gegossen und vernich- tet; Fellen – für Indianer wichtige Tauschobjekte – ergeht es ebenso. Dieses hemmungslose Vernichten von Werten soll Reichtum und Größe symbolisieren – oftmals sicher nicht in Übereinstimmung mit der Realität.
In orientalischen Kulturkreisen gilt der Ernährungszustand einer Frau – auch heute noch – als Symbol für die Effektivität ihres Versorgers. Mollige Propor- tionen einer Angetrauten sicherten in geschichtlichen Zeiten – in Zeiten ge- nereller Nahrungsknappheit – einen Mann Achtung, Ansehen und Respekt. Diese Tradition hat sich in ihrer ursprünglichen Form bis heute erhalten; sie erklärt die Vorliebe, die Männer – im Allgemeinen – molligen Damen in diesen Kulturkreisen entgegenbringen.
Auch Tiere füttern sich als Erwachsene
Schon beim Schimpansen, unseren nächsten Verwandten, kann man das Teilen von Nahrung nach einem Jagderfolg beobachten. Fleisch hat bei ihnen einen hohen Stellenwert. Die ganze Bande ist deshalb beständig darauf aus, sich diese eiweißhaltige Kost zu beschaffen. War einem das Jagdglück hold und hat er es geschafft, sich z. B. eines Colobus–Äffchens zu bemächtigen, wird die Jagdbeute anschließend auch an seine Kumpane verteilt – die geduldig darauf warten, einen kleinen Fetzen abzubekommen.
Futtergaben, die ein Tier dem anderen macht, sind in der Natur weit verbrei- tet. Männliche Tiere, die sich bei der Aufzucht der Jungen beteiligen, müssen den umworbenen Damen vor der Paarung beweisen, dass sie gute Versorger sind. Sie tun dies durch Futterstückchen, die sie zum Rendezvous mitbringen. Nur wenn die Angebetete mit Menge und Qualität zufrieden ist – sagt sie ja.
Anrührend ist auch das Kussfüttern, das z. B. manche Vogelarten prakti- zieren, und bei dem sich das Weibchen füttern lässt wie ein Junges. Das menschliche Küssen hat übrigens seinen evolutionären Ursprung in einem ähnlichen Kontext: Frühmenschen zerkauten schwer zu zerkleinernde Nah- rung und fütterten den Brei anschließend Mund zu Mund ihren Kleinkindern. Der erotische Kuss leitet sich von dieser Mund–zu–Mund–Fütterung ab, die im Laufe der Evolution einen Bedeutungswandel erfahren hat.
| Vorwärts im Text: |